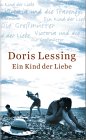23. Mai 2008, 21 h
Marguerite Duras Hiroshima, mon amourZwei Menschen begegnen sich. Wie? Das ist unwichtig. Was man von ihnen weiß, ist, dass sie nun gemeinsam in einem Zimmer liegen, eng umschlungen, und sich unterhalten. Wo? Das ist schon wesentlicher. In Hiroshima. Und sie ist hier, weil sie bei einem Film mitwirkt. Einem Friedensfilm, wie sie zu dieser Zeit häufig in Hiroshima gedreht werden. Und er? Er lebt hier.
Sie wird in wenigen Stunden abreisen. Und sie will ihn in dieser Zeit nicht mehr sehen. Doch er kommt zum Drehort, und wieder geht sie mit ihm. Und diesmal erzählt sie ihm - erzählt ihm das, was sie seither niemandem erzählt hat. Von ihrer Liebe zu dem deutschen Soldaten in Nevers und wie dieser erschossen wird. Und sie nur noch bei ihm bleiben kann, bis er stirbt - und dann als Kollaborateurin geschoren wird. Den Rest des Krieges im Keller verbringt.
Bleib, bittet er sie. Doch sie kann nicht. Will nicht. Kann nicht...

11. April 2008
Wolfgang Koeppen Jugend Wolfgang Koeppen, geboren in Greifswald, unglücklich in »Pommerland«, erfindet einen, der ihm ähnlich ist, einen, der wie er aus Greifswald stammt und ebenso heimatverdrossen ist. Seinem Protagonisten legt er die Abscheu in den Mund, die anders vielleicht nicht auszusprechen wäre: »Ich haßte die Stadt hinter den Wiesen, die berühmte Silhouette, die der Maler gemalt hatte« (S. 142). Die »Stadt hinter den Wiesen« mit der Universität, mit der Langen Straße, der Hunnenstraße, mit der Nähe zum Fischerdörfchen Wieck und zur Ostsee, ist Greifswald und doch bei aller Deutlichkeit lediglich ein Synonym für die arge Provinz, der es zu entkommen gilt: »ich dachte an Flucht aus dieser Stadt, aus diesem Land, Flucht, Flucht, und ich folgte dem Schauspiel« (S. 127).
Der eine ist in diese Stadt hineingeboren, Sohn eines Ballonfahrers (eigentlich Privatdozent für Augenheilkunde), unehelich, »von Anbeginn verurteilt« (S. 68). Seine Mutter Maria ist jung. Sie ist arm und verlassen. Sie arbeitet als Weißnäherin für die umliegenden Güter, später als Souffleuse im Theater. Maria liebt die Stadt. Sie kennt keine andere. Von ihr wird er das Fahrgeld für ein Nimmerwiedersehen nicht bekommen. Er muss bleiben, als längst Ausgestoßener. Ein nur vermeintlicher Ausweg ist das »Militär-Knaben-Erziehungs-Institut« (S. 44), wo er, zwölfjährig, der nichts ist außer ein »Klotz« (S. 42) – oder schwerer – ein »Stein« am Bein der Mutter (S. 45), plötzlich »Deutschlands Zukunft« (S. 51) wird. Von einer Grippe übermannt, träumt er den »Heldentod«, doch im letzten Moment – wie es scheint – kommt wieder sie, Maria, ihn zu holen, zurück in die Stadt wo seine Jugend spielt und doch nicht spielt: »In meiner Stadt war ich allein. Ich war jung, aber ich war mir meiner Jugend nicht bewusst. Ich spielte sie nicht aus. Sie hatte keinen Wert. Es fragte auch niemand danach. Die Zeit stand still. Es war eher ein Leiden. Doch gab es keinen, der mir glich« (S. 127). Vielleicht glich ihm tatsächlich keiner, in der Zeit, die drängte, doch still stand, zur Zeit des Kaiserreichs bzw. der Weimarer Republik, den beiden Epochen der
Jugend. Dennoch gibt es weitere Ausgestoßene, Randfiguren, auf die Koeppen es in seinem Buch abgesehen hat: Käthe Kasch zum Beispiel, Freundin der Mutter, blinde Pianistin, die der Sohn zur Polizeistunde nach Hause begleitet. Sie spielt in der Fledermausdiele bei Rotlicht und »geschwärzten Fenstern« (S. 77) und bezahlt ihn mit Millionen, die doch wertlos sind. Oder Tante Martha, Amtsgerichtsrat, Vormundschaftsrichter, schwul in seiner Art, deshalb verpönt, eben nicht wie die braven Bürger, sondern »gutherzig und angesprochen von Jugend und nicht ohne Zweifel am Gesetz und der allgemeinen Sitte«, vielmehr durchsetzt von »Freundlichkeit« sowie »Einsicht und Trauer gegen die ihm aufgepreßte Strenge« (S. 99). »Tante Martha war eine stadtbekannte Persönlichkeit und gehörte schon längst zu den Menschen, die mich beschäftigten, denen ich heimlich folgte, in die ich mich verwandelte, um sie zu erkennen und wie sie zu träumen« (S. 97). Alles Einbildung, will der Autor uns sagen und schreibt es seinem Verleger: »Es ist mehr Dichtung als Wahrheit. Erinnerungen an eine fremde Jugend, eigentlich Kindheit, Alpträume von einem anderen. Ich habe diese Wohnung nicht bewohnt, war auch nie in einer Militärerziehungsanstalt, verbrachte meine Schuljahre in Ostpreußen und nicht in Pommern, wuchs nicht in einem Milieu extremer Armut auf, aber ich hatte diese Empfindungen, oder sie kamen mir beim Schreiben« (Wolfgang Koeppen an Siegfried Unseld, München, 2. April 1976).
Jugend als Autobiographie Koeppens missverstehen, würde demnach bedeuten, den Sinn des Buches vorschnell zu verwischen.
Jugend ist kein autobiographisches, es ist ein in höchstem Maße persönliches Buch. Der Text endet, wie er begonnen wurde, mit der Mutter: »Ich schrieb, meine Mutter fürchtete die Schlangen« (S. 142). Die Mutter endet mit dem Ende des Textes, sie stirbt.
Jugend ist ein Epitaph: auf die Mutter, auf die Jugend, auf die Literatur. Nur so lässt sich die Enge allen Geschehens lösen, mithilfe der Literatur gelingt die ewige Flucht in die erträglichen Zwischenräume der Phantasie

7. März 2008
Drei FrauenIn diesen Erzählungen tastet Musil in das Dunkel jenes unfaßbaren Seins, das die Grenze unseres Menschentums umgibt und uns noch Dinge vermittelt, die schon außerhalb unseres Lebens zu sein scheinen. Drei Frauen: der Bäuerin, der portugiesischen Aristokratin und der Verkäuferin stehen drei Männer gegenüber, die durch sie ihre Tragik erleiden. Eine große Fremdheit liegt hier zwischen den Geschlechtern, und gerade in dieser Spannung zeigt sich Musils eigentliche Stärke, hineinzuwandern in die seelischen Labyrinthe und Hintergründe.
Robert Musil, 1880 in Klagenfurt geboren, starb 1942 in Genf. Zu seinen wichtigsten Werken gehören u.a. 'Die Verwirrungen des Zöglings Törless', 'Drei Frauen', 'Nachlass zu Lebzeiten' und 'Der Mann ohne Eigenschaften'.

25. Januar 2008
ECCE HOMO
»Ich kennen mein Loos. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, - an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab.«
Wer Nietzsches Ecce homo zur Hand nimmt, muss sich viele Frage stellen. Er kommt nicht umhin, zumindest für sich selbst zu klären, was von diesem Text und von der geistigen Verfassung seines Autors zu halten ist. Denn Ecce homo ist ein maßloses Buch eines maßlosen Menschen in maßloser Absicht.
Nietzsche polemisiert darin heftig gegen Moral, Seele, Geist, freien Willen und sogar Gott. Und er verkündet seine Weisheit, zu der es gehört, dass sie niemals schon gefunden, sondern immer erst zu suchen ist.
Mit einem Nachwort von Volker Gerhardt.
Über den Autor
Friedrich Nietzsche (1844-1900) stammte aus einer evangelischen Pfarrersfamilie, besuchte die renommierte Landesschule in Pforta bei Naumburg, studierte in Bonn und Leipzig und wurde mit 25 Jahren Professor der klassischen Philologie in Basel. Er war ein genialer Denker, Meister der Sprache und begabter Musiker und Komponist. Sein Leben war bestimmt von problematischen Beziehungen, etwa zu Richard Wagner oder Lou Andreas-Salomé, und endete in der bedrückenden Einsamkeit des Wahnsinns. Seine Werke von der »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« bis »Also sprach Zarathustra« gewannen großen Einfluss auf die Philosophie und Literatur des 20. Jahrhunderts. Heute gilt er als einer der wichtigsten Wegbereiter der Moderne.